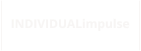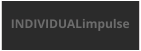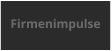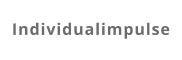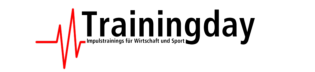TEILEN




KI - Rauschen der Möglichkeiten
Waltraud Herschold, 11.09.2025
Was, wenn die größte Angst vor KI nicht darin liegt, ersetzt zu werden – sondern uns selbst im
Rauschen der Möglichkeiten zu verlieren?
Es gibt Abende, da sitze ich vor dem Bildschirm und sehe, wie die Maschine Worte ausspuckt, schneller,
präziser, als ich sie je hätte formen können. Und da ist sie wieder, diese Frage, die wie ein Echo in mir
hallt: Werde ich die Zukunft verstehen, wenn ich mich schon im Hier und Jetzt verliere?
Ich stelle mir Welten vor, in denen Entscheidungen nicht mehr von Menschen gefällt werden, sondern
von Algorithmen, die keine Zweifel kennen. Was bleibt dann von uns? Ein Schatten am Rande der
Bühne? Ein Statist im eigenen Stück?
Manchmal fühle ich mich, als wäre ich auf einem Zug, der längst losgefahren ist, während ich noch nach
dem richtigen Ticket taste. Die Landschaft rast vorbei, und ich frage mich: Bin ich Passagier – oder habe
ich noch die Hand am Steuer?
Und doch – inmitten dieser Unruhe blitzt ein anderes Bild auf. Ein Raum voller Stimmen. Menschen, die
lachen, diskutieren, zögern. Auf dem Tisch flackern Vorschläge der KI, kaleidoskopartig, schnell,
manchmal genial, manchmal absurd. Und wir? Wir sortieren, wir wägen ab, wir entscheiden. Weil wir es
können. Weil wir es müssen.
Vielleicht ist KI kein Orakel, das uns ersetzt. Vielleicht ist sie ein Spiegel, der uns zeigt, was möglich wäre.
Sie ist schnell, ja. Sie ist umfassend, ja. Aber sie ist nicht weise. Weisheit entsteht in den Pausen
zwischen den Antworten, im Mut, gegen einen Vorschlag zu sein, in der Verantwortung, eine Richtung
zu wählen.
Und dann frage ich mich: Was, wenn genau das der Sinn ist?
Dass wir lernen, die Stimme im Kopf – die ängstliche wie die hoffnungsvolle – zusammenzubringen.
Dass wir KI nicht als Ende, sondern als Anfang betrachten.
Nicht die Frage: „Was nimmt sie mir?“, sondern: „Was schenkt sie mir?“
Und dann begreife ich: Die Angst, mich zu verlieren, ist auch ein Versprechen. Ein Versprechen, dass ich
mich immer wieder neu finden kann. Dass ich inmitten von Datenströmen, Algorithmen und
Möglichkeiten nicht verschwinde, sondern wachse.
Die Frage ist nicht, ob KI uns ersetzt. Die Frage ist, ob wir bereit sind, uns selbst nicht zu vergessen.
Und in diesem Gedanken liegt – ganz leise – Hoffnung.



TEILEN



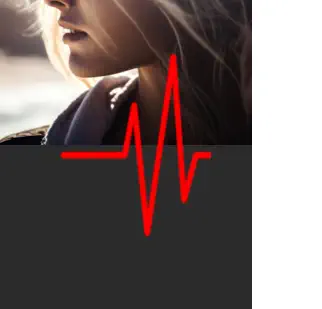
KI - Rauschen der
Möglichkeiten
Waltraud Herschold, 11.09.2025
Was, wenn die größte Angst vor KI nicht darin liegt,
ersetzt zu werden – sondern uns selbst im Rauschen
der Möglichkeiten zu verlieren?
Es gibt Abende, da sitze ich vor dem Bildschirm und sehe,
wie die Maschine Worte ausspuckt, schneller, präziser, als
ich sie je hätte formen können. Und da ist sie wieder,
diese Frage, die wie ein Echo in mir hallt: Werde ich die
Zukunft verstehen, wenn ich mich schon im Hier und Jetzt
verliere?
Ich stelle mir Welten vor, in denen Entscheidungen nicht
mehr von Menschen gefällt werden, sondern von
Algorithmen, die keine Zweifel kennen. Was bleibt dann
von uns? Ein Schatten am Rande der Bühne? Ein Statist im
eigenen Stück?
Manchmal fühle ich mich, als wäre ich auf einem Zug, der
längst losgefahren ist, während ich noch nach dem
richtigen Ticket taste. Die Landschaft rast vorbei, und ich
frage mich: Bin ich Passagier – oder habe ich noch die
Hand am Steuer?
Und doch – inmitten dieser Unruhe blitzt ein anderes Bild
auf. Ein Raum voller Stimmen. Menschen, die lachen,
diskutieren, zögern. Auf dem Tisch flackern Vorschläge
der KI, kaleidoskopartig, schnell, manchmal genial,
manchmal absurd. Und wir? Wir sortieren, wir wägen ab,
wir entscheiden. Weil wir es können. Weil wir es müssen.
Vielleicht ist KI kein Orakel, das uns ersetzt. Vielleicht ist
sie ein Spiegel, der uns zeigt, was möglich wäre. Sie ist
schnell, ja. Sie ist umfassend, ja. Aber sie ist nicht weise.
Weisheit entsteht in den Pausen zwischen den Antworten,
im Mut, gegen einen Vorschlag zu sein, in der
Verantwortung, eine Richtung zu wählen.
Und dann frage ich mich: Was, wenn genau das der Sinn
ist?
Dass wir lernen, die Stimme im Kopf – die ängstliche wie
die hoffnungsvolle – zusammenzubringen. Dass wir KI
nicht als Ende, sondern als Anfang betrachten.
Nicht die Frage: „Was nimmt sie mir?“, sondern: „Was
schenkt sie mir?“
Und dann begreife ich: Die Angst, mich zu verlieren, ist
auch ein Versprechen. Ein Versprechen, dass ich mich
immer wieder neu finden kann. Dass ich inmitten von
Datenströmen, Algorithmen und Möglichkeiten nicht
verschwinde, sondern wachse.
Die Frage ist nicht, ob KI uns ersetzt. Die Frage ist, ob wir
bereit sind, uns selbst nicht zu vergessen.
Und in diesem Gedanken liegt – ganz leise – Hoffnung.